Morgenarbeit: von der Longe bis zur Arbeit an der Hand
Das Reitinstitut Egon von Neindorff bietet seit Jahrzehnten umfassenden Unterricht von den Grundlagen bis zu den höchsten Stufen der klassischen Reitkunst. Die öffentliche Morgenarbeit gibt interessierten Reitern die Möglichkeit, die klassische Philosophie hautnah zu erleben sowie den Leiter des Reitinstituts und erfahrenen Ausbilder Axel Schmidt mit allerhand Fragen zu löchern.
Am 27. Juli 2025 fand die dritte und letzte öffentliche Morgenarbeit des Sommers statt. Nach den vorangegangenen Veranstaltungen zur Sitzschulung und zur Arbeit mit jungen Pferden widmete sich diese Morgenarbeit dem weitreichenden Thema der Arbeit an der Longe und an der Hand.
Die Basis: Korrektes Führen als Fundament
Im historischen Reithaus demonstrierte Herr Schmidt, wie scheinbar einfache Übungen die Grundlage für die hohe Reitkunst bilden. Er betonte, dass bereits das korrekte Führen des Pferdes den Grundstein für alle weitere Arbeit legt. Diese Vorbereitung beginne schon bei den Fohlen, die ohne Zwang das Anbinden und Mitgehen mit ihren Müttern lernen. Die Disziplin, die man vom Pferd fordert, fängt mit der Disziplin des Reiters an: er muss Ruhe, eine gleichförmige Herangehensweise und Vorhersehbarkeit etablieren, um den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Fluchttier Pferd zu legen.
Longieren: Mehr als nur im Kreis laufen
Die gute Longenarbeit dient als Ausgangspunkt für die gesamte Ausbildung eines Reitpferdes, aber auch der Kräftigung und der kontrollierten Bewegung von Pferden, die gesundheitsbedingt nicht geritten werden können. Als erste Übung empfiehlt Schmidt beim Longieren das sichere Anhalten und Stillstehen, gefolgt vom kontrollierten Antreten im Schritt. Die korrekte Handhabung der Longe, das unverdrehte Aufrollen zur Aufbewahrung und sicheren Nutzung sowie die richtige Position des Longenführers – ja diese ist wichtig, sie kann treibend oder verhaltend wirken – sind entscheidende Sicherheitsaspekte, die Unfälle vermeiden helfen.
Bei der Longenarbeit wies Schmidt auf häufige Fehler hin. Heutzutage werden junge Pferde oft von oben bis unten mit Bandagen und Stützen eingepackt, was nicht nur unnötig sei, sondern im schlimmsten Fall das Körpergefühl störe. Wichtiger ist die ruhige Hand des Longenführers, denn selbst beim Kappzaum stört eine unruhige Verbindung das sensible Pferd erheblich.
Von den Grundgangarten zur Piaffe – oder andersrum?
Mit verschiedenen Pferden demonstrierte Schmidt Piaffetritte und erläuterte die Handhabung der Touchierpeitsche sowie die verschiedenen Touchierpunkte beim Pferd. Das Wichtigste sei das Beenden der Übung im richtigen Moment. Das ruhige Stehen zwischen den Übungen und immer wieder Pausen einlegen, sei maßgeblich, betont Schmidt. Nach jeder Übung ist immer wieder die Dehnungshaltung zu erlauben, so dass sich das Pferd erholen und entspannen kann. Herr Schmidt erläutert, dass sich die Reihenfolge der Ausbildung bei den alten Reitmeistern grundlegend von der heute oft praktizierten Vorgehensweise unterscheidet. Die Galopparbeit erfolgte beispielsweise erst nach der Ausbildung von Piaffe und Passage. Denn die Piaffearbeit fördert die für guten Galopp nötige Balance des Pferdes und ist hier eine Übung innerhalb der Ausbildung, keine Schaunummer für das Viereck.
Das Pferd im Zentrum – das Pferd als Lehrer
Grundlage jeder Arbeit ist das Vertrauen des Pferdes in seinen Reiter, welches man sich zu erarbeiten habe. Besonders deutlich wird dies bei der Arbeit am langen Zügel, denn der Reiter läuft direkt an der Hinterhand des Pferdes. Ohne Vertrauen unmöglich. Eine Reiterin beweist dies, als sie ihren Lipizzanerhengst am langen Zügel vorstellt.
Das immer wieder zu hörende zufriedene Abschnauben der Pferde während der gesamten Morgenarbeit beweist ihr Wohlbefinden. Am Reitinstitut steht das Pferd im Zentrum, die Übungen werden zur Gesunderhaltung und Kräftigung der Reitpferde durchgeführt und nicht um der „Show“ willen. Ist ein Pferd weit genug ausgebildet, so kann es zum Lehrpferd werden und im Unterricht zum Einsatz kommen. Man verstehe das nicht falsch – ein Lehrpferd sei kein Roboter, der alles gehorsam ausführt, erklärt Herr Schmidt. Es reagiert nur auf korrekte Hilfen und zeigt dem Schüler unmittelbar, wo es noch hapert. Das Pferd stellt Fragen wie ein guter Lehrer und führt den Schüler manchmal auch physisch auf den Boden der Tatsachen zurück.
Schmidt erzählte von seiner eigenen demütigenden Erfahrung als junger Military-Reiter bei Egon von Neindorff. Trotz seiner vielen Turnier-Auszeichnungen machte das Lehrpferd des Meisters mit ihm im Sattel keinen einzigen Schritt vorwärts. In diesem Moment habe er erkannt, wie viel er noch zu lernen hatte. Heute – Jahrzehnte später, kann Schmidt betonen, dass die klassische Reitkunst kein Hexenwerk sei, sondern geduldige, gewissenhafte und jahrelange Arbeit an sich selbst und mit dem Pferd erfordert. Keine Tricks oder Schleichwege, sondern ehrliches Arbeiten führen zum Ziel. Das Pferd bleibt dabei immer die wichtigste und untrügliche Prüfinstanz, die stets eine direkte Antwort gibt. Wichtigste Aufgabe des Reiters aber ist es, diese Antwort wahrzunehmen, zu verstehen und entsprechend zu handeln. Und die wichtigste Aufgabe des Egon von Neindorff Reitinstituts ist es das benötigte Wissen mit seinem Lehrangebot an alle Interessierten weiterzugeben.
Text: C.Stern-Guptill|J.Meyer
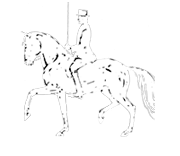
 Christine Stern-Guptill
Christine Stern-Guptill
